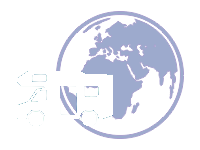Als wir vor mehr als einem Jahr nach Australien gekommen sind, waren wir unter anderem sehr darauf gespannt, wie die Aborigines als Nachfahren der Ureinwohner des Kontinents heute leben. Inzwischen haben wir sie überall gesehen: an Supermarktkassen, in Bäckereien, als Ranger und in Familien, aber auch in betrunkenen Horden. Manche Aborigines scheinen in die heutige Gesellschaft gut integriert zu sein, andere dagegen stehen im völligen Abseits.
Auf den ersten Blick tut die Regierung viel, um den Besuchern das Leben und die Kultur der Ureinwohner und deren Nachfahren näher zu bringen. Vielerorts stehen Infotafeln, und nicht selten gibt es in den Besucherzentren Kunstgegenstände, die von den Aborigines hergestellt wurden. Auf vielen der Malereien sind Elemente der Traumzeitgeschichten dargestellt. Ehe wir jedoch bewusst die ersten Vertreter der Aborigines wahrgenommen hatten, waren immerhin schon einige Wochen unserer Reise vergangen. Und die Begegnung in Ceduna, im Süden von Australien, war ein erster Schock: Einige Stammesvertreter torkelten in zerlumpter Kleidung durch den Ort und bettelten uns an.
Bald verschwanden diese Bilder wieder aus unserem Gedächtnis, hatten wir doch an der Ostküste kaum indigene Bevölkerung getroffen. Jedoch fragten wir immer wieder nach, wo denn die Aborigines seien. Die sind integriert, hieß es, ganz normale Menschen, wie Du und ich. Umso erstaunter waren wir, als uns im Northern Territory erneut Menschen wie in Ceduna begegneten. Die sind in ihre ursprünglichen Stammesgebiete zurückgekehrt, hieß es nun. Die australische Regierung hat ihnen ihr Land zurückgegeben. Dazu gab es noch jede Menge Geld, damit sich die Leute eine Existenz aufbauen können. Das interessierte uns nun doch mehr, zumal die Aborigines im Zentrum Australiens zum täglichen Straßenbild gehören. Dass ein Großteil von ihnen integriert sei, kann man allerdings nur schwer glauben. Informationen fließen nur spärlich, da die einen mit den anderen offenbar nicht viel zu tun haben wollen. Sicherlich sind mit staatlichen Förderprogrammen einige Farmen und Geschäfte entstanden. Betrieben werden die aber häufig nicht nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern scheinbar nach Tagesform der Besitzer. Viel zu oft sind die Läden und Kulturzentren aus unerfindlichen Gründen geschlossen.
In Alice Springs fragten wir nach einem Ort, wo man sehen kann, wie die Aborigines heutzutage leben. Im Besucherzentrum nannte man uns einige Gemeinden, wo man auch Touristen empfangen würde, man solle aber unbedingt vorher anrufen. Das taten wir nicht, sondern sperrten weiter unsere Augen auf.
So ist beispielsweise die Gegend um den weltbekannten Uluru eine Aborigine Gemeinde. Dort gibt es ein Kulturzentrum, das wir uns unbedingt anschauen wollten. Begeistert waren wir am Ende nicht. Neben den ausgestellten Kunstgegenständen liefen ewig lange Filme, die von der Landrückgabe der australischen Regierung berichteten. Kein Einheimischer war anwesend, den man zum Leben der Aborigines und vor allem zur Bedeutung des heiligen Uluru befragen konnte. Ähnliches passierte uns später auch im Kakadu Nationalpark.
Auf dem Weg nach Norden sahen wir am Straßenrand so viele verendete Rinder wie sonst nirgendwo in Australien. Die Tiere sind meistenteils von den Roadtrains überfahren worden. Kein Wunder, denn die Weiden sind hier entweder schlecht oder gar nicht umzäunt. Viehhaltung ist keine traditionelle Arbeit im Leben der Ureinwohner. Die nomadisch lebenden Völker gingen früher jagen. Essen gibt es mittlerweile im Überfluss, und Geld für Nahrungsmittel haben die Leute auch. So machen sie sich offenbar über den Verlust von einigen Tieren keine Gedanken, außer, dass es weniger Arbeit ist. Jammerschade, wenn man weiß, was so ein Rind wert ist.

Fehlt es hier an Bildung? Wir fragten in der School of the Air in Alice Springs nach. Im weltweit größten Klassenzimmer, wie die Schule sich nennt, werden Kinder in den entlegensten Gebieten Australiens an Telearbeitsplätzen unterrichtet. Die Kinder der Aborigine gehören nur selten zu den Schülern, sie gehen in ihren Stammesgemeinden zur Schule. Dort könne man sowohl sprachlich als auch sachlich besser auf die Umstände eingehen, in denen diese Kinder leben, hieß es. Aha!
Als wir durch Tenant Creek fuhren, hatten wir den Eindruck, dass die Schule für Aboriginekinder auf der Straße stattfindet. Munter schlenderten die Eltern mit ihrem Nachwuchs durch die Supermärkte, und das zu Zeiten, wo Kids eigentlich in der Schule sein sollten. An Geld scheint es dabei nicht zu mangeln. Die Einkaufskörbe sind voll und manch einer leistet sich teure Kleidung. Andere wiederum setzen das Geld in Alkohol und Zigaretten um. Am Rasthaus Aileron torkelte zur Mittagszeit eine Gruppe stockbetrunkener Aborigines laut grölend auseinander. Die meisten von ihnen konnten ihre Zigaretten kaum noch halten. Man braucht in Australien schon ein kleines Vermögen, um sich täglich so die Kante zu geben. Bezeichnend war, dass die ganze Fete unter den wachsamen Augen stolzer Aborigines stattgefunden hat, die als übergroße Denkmalsfiguren das Roadhouse zieren.
Und schließlich kamen wir nach Hermannsburg. Der Ort wirkte gespenstisch auf uns. Auf der Straße war kein Mensch zu sehen. Die Häuser wirkten ungepflegt, vor einigen Gebäuden stapelten sich Schrottautos. Der Campingplatz hatte geschlossen, weil der Supermarkt zu war. Und der Supermarkt war geschlossen, weil zurzeit niemand die Tankstelle bewirtschaftete. In die Seitenstraßen konnte man nicht hineinfahren. Auf Schildern bittet man, die Privatsphäre der dortigen Anwohner zu respektieren. Am Ende wurden wir vom Museumverwalter des Hermannsburger Precinct empfangen. Auf unsere Frage nach dem Leben im Ort meinte der Mann, dass wir hier in einer typischen Aboriginesgemeinde gelandet seien. Hermannsburg war früher eine der ersten Stationen wo man versuchte, die Ureinwohner zu missionieren, ihnen christliche Lebensweisen und Tugenden beizubringen. Ob das gelungen ist, wissen wir nicht. Auf alle Fälle haben die ursprünglichen Volksstämme ihr Land zurückbekommen und ziehen sich zurück, bis auf einige, die wirklich in der heutigen Gesellschaft angekommen sind.
Einer von ihnen ist Capes. Wir trafen den Mann an der Westküste. Voller Stolz präsentierte er uns sein Land, zu dem der Francois-Peron-Nationalpark gehört. Und voller Inbrunst lebte er alte Bräuche, indem er auf dem Sand niederkniete und täglich sein Land begrüßte. Mit Freude erklärte er Pflanzen und Tierwelt auf seinem fantastischen Stück Erde und gab uns Früchte zum Kosten, an denen wir normalerweise achtlos vorbeigelaufen wären. Als Jörg das Gespräch auf die Integration in der Gesellschaft brachte, wurde Capes sehr still. Viele schaffen es nicht und wollen es auch gar nicht.

Kein Wunder, die Traumzeitgeschichten lassen sich vermutlich nur noch im Alkoholrausch träumen. Viele der Rituale sind vor mehr als 200 Jahren verloren gegangen, als die Ureinwohner der Verlockung erlegen waren, ihr ursprüngliches Leben gegen Glanz und Glamour, den die Europäer mitbrachten, einzutauschen. Wer das nicht wollte, wurde von der Kolonialmacht gezwungen. Die Urahnen hatten keine Chance, ihr gewohntes Leben weiter zu leben, genau so wenig, wie sie heute keine Chance haben, zu diesem Leben zurück zu kehren. Die Welt hat sich einfach zu sehr verändert.
Heute sind scheinen die Nachfahren der Ureinwohner mit Geld sozial abgesichert zu sein. Die einen nutzen es, um sich zu integrieren, die anderen träumen weiter, oft im Alkoholrausch. So wie wir die Aborigines erlebt haben, bleibt in uns eine tiefe Zerrissenheit.